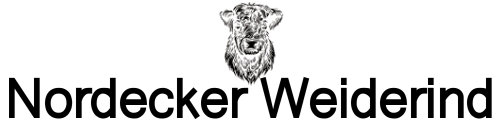Flurnamen in Nordeck
Von Flurnamen im Bereich des heutigen Ortes Nordeck werden im Folgenden die bekannten Flurnamen aufgeführt und im sachlichen Zusammenhang gedeutet. Neben den Bezeichnungen in Deutsch sind zudem noch die Bezeichnungen in Mundart angegeben: In eckigen Klammen die Namen nach dem hessischen Flurnamenarchiv und in eckigen Klammern die Namen nach dem Buch „Bei iis deheem – Die nordecker Mundart“ von Helma Arnold.
Bachgraben (Bachgròòwe)
Durch den Bachgraben läuft heute unterirdisch das Wasser aus dem Elmensee, ehe es auf der Kreuzung zwischen dem Bachgraben, dem Weitershäuser und Mirtchesacker und dem trockenen See wieder als Bach an die Oberfläche tritt.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Bach: Zu althochdeutsch. bah, mittelhochdeutsch. bach st. M. F. ‚Bach‘. Mit Bach wird in der Regel der Hauptwasserlauf einer Gemarkung bezeichnet. – In Bachhans liegt ein PN vor, wobei der erste Namenteil Familienname oder Beiname sein kann (‚der am Bach wohnt‘).
Graben: Zu ahd. grabo, mhd. grabe sw. M. ‚Graben‘, einer Ableitung vom starken Verb ahd. graban, mhd. graben. Die FlN können sich auf natürliche oder künstlich angelegte schmale Wasserläufe, aber auch auf die Dorfbefestigung beziehen. – Bei Pluralformen kann Vermengung mit Krebe (s. d.) auftreten.
Der Hohestein (die Waldflur ist eher unter Hohe Eiche (Huuk Äche) bekannt)
Bezieht sich auf ein hoch gelegenes Flurstück oder auf natürliche und künstliche Gegebenheiten in der Flur, die durch ihre Größe die Umgebung überragen (hoher Berg, hohe Eiche). Hohe Steine verweisen entweder auf hoch auftragende (Grenz-) Steine oder auf prähistorische Monolithe.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Hohe: Die Flächennutzung beziehen sich entweder auf hoch gelegene Flurstücke (Hochfeld) oder auf natürliche und künstliche Gegebenheiten in der Flur, die durch ihre Größe die Umgebung überragen (hoher Berg, hohe Eiche). – Hochholz geht zurück auf mhd. hôchholz st. N. ‚Hochwald‘ und bezieht sich auf einen Wald, der aus hochstämmigen Laub- oder Nadelbäumen besteht (im Gegensatz zum Busch- oder Niederwald). Hohe Straßen sind in der Regel alte Fernwege. Hochgericht benennt eine Hinrichtungsstätte. – Durch Teilassimilation entsteht mitunter Hom als BT, aus *an deme hôhen berge u. ä.; auch der Hombrich in Wißmar gehört dazu, wobei sich im GT die mündliche Aussprache /b(e)rich/ ‚Berg‘ spiegelt. Humland in Frankenbach wird auf *am hôhen lant zurückgehen. Einzig der Hombiegel, ein ‚Bühl‘ (s. d.) in Hausen, scheint im BT nicht auf hoch sondern auf Hund (s. d.) zurückzugehen und damit evtl. auf einen Gerichtshügel zu verweisen.
Das hohe Rod [eam hü road]; (s huuche Ròòid)
Durch Rodung von Wald urbar gemachtes, hochgelegenes Stück Land.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Rod: Zu althochdeutsch rot, rod, mittelhochdeutsch. riute st. Nutzungsform ‚Rodung, durch Rodung urbar gemachtes Stück Land‘. Die zahlreichen Belege weisen eine Fülle von sprachlichen Varianten auf. Neben den häufigen /ro:t, rot/-Formen sind es vor allem /rö:de/-Formen. Soweit sie als Sg. fem. identifizierbar sind, gehen sie auf eine Nebenform von mhd. riute zurück, in der der Stammvokal gekürzt uns zu /ö/ gesenkt ist, um dann durch die Dehnung in offener Silbe zu /rö:de/ zu werden. /rö:de/ kann aber auch Plural zu Rod sein und konkurrieiert dann mit der Pluralform auf /-er/: Röder, mundartlich oft zu /re:rer/ entrundet und weiter zu /ri:rer/ gehoben. Rod-Formen erscheinen häufiger mit Senkung zu /a/ (Rad). Bei mündlichen /u:/-Formen wurde in der Regel angenommen, dass sie zu rot gehören, womit Vermengung ohnehin leicht möglich ist. Für den /d/-Laut kommt neben regelmäßigem Rhotazismus zu /r/ gelegentlich Lamdbazismus zu /l/ vor (Röder Loch in Odenhausen (Rabenau)). – In diesem wie in einigen andern Fällen ist nicht auszuschließen, dass die Namen an SiedlungsN Rod erinnern, über die aber nichts weiter bekannt ist.
In der Bornwiese [eann de bonnwesse] (Bonnwesse)
Namensgebend sind natürlich fließende, nicht gegrabene Quellbrunnen, aus denen geschöpft werden konnte; auch kleine Quellbrunnen im Walde und Wiesenquellen. Auch heute noch fließt ein kleiner Bach durch die Flur.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Born: Zu althochdeutsch. brunno, purnno, mhd. burne, born sw. M. ‚Brunnen, Quelle‘. Namengebend sind natürlich fließende, nicht gegrabene Quellbrunnen, aus denen geschöpft werden konnte; auch kleine Quellbrunnen im Walde und Wiesenquellen. Born ist eine mitteldt./niederdt. Form und durch /r/-Metathese aus oberdt. Brunnen, ahd. brunno, ‚Brunnen‘ entstanden.
Wiese: Zu althochdeutsch. wisa, mittelhochdeutsch. wise sw. st. F. ‚Wiese‘. In dem Flurnamen zeigt sich die allgemeine Bedeutung ‚zu mähende (kultivierte) Grünfläche‘.
Steinacker [off’m steeäcker] (Schdeeäger)
Geht auf die steinige Bodenbeschaffenheit ein.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Acker: Zu althochdeutsch. ackar, mittelhochdeutsch. acker st. M. ‚Acker, Feld‘. In Flurnamen ist Acker im Untersuchungsraum über zweitausendmal belegt. Die sehr allgemeine Bedeutung (‚bebautes Land‘) erklärt die weite Verbreitung und das überwiegende Vorkommen als GT von Namenkomposita. Bei diesen sind hinsichtlich des namengebenden Motivs verschiedene Typen zu unterscheiden: die Benennung erfolgte nach dem Namen, Amt oder rechtlichen Status des Grundbesitzers (z.B. Herrenacker), nach der Beschaffenheit und Nutzung des Bodens (z.B. Steinacker), nach der Größe und Form des Geländes (z.B. Langacker), nach der relativen Lage zu bestimmten topographischen Punkten (z.B. Mühlacker) usw. In den frühen Belegen ist die Grenze zwischen Appellativ und Name manchmal noch fließend. Selten taucht Acker als BT oder Simplex auf.
Ganskopf (off’m gaaskopp) (Gaaskobb)
Dies könnte auf eine Weidenutzung für Gänse hindeuten aber auch auf die Grundstücksform in Form einer Gans.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Gans: Die Mehrzahl der Flächen wird nach ihrer Nutzung als Weide für Gänse benannt. Darauf verweisen auch Namen wie Gänseberg, -garten, -tränke, -brunnen/-born. Auch Wege, auf denen die Gänse zu den Weideflächen getrieben wurden, waren für Flurnamen namengebend. Darüber hinaus konnten Gänse als Naturalabgabe für die Nutzung eines Flurstücks eingesetzt werden. Daran erinnern neben Namen wie Ganszehnten wohl auch die meisten Gänsäcker, denn auf Äckern wurden ja keine Gänse gehalten.
Kopf: In den Flurnamen kann die Bedeutung ‚kleine Erderhöhung, rundlicher Hügel, Bergkuppe‘, aber auch ‚äußerstes Ende‘ und in diesem Sinne ‚der an der Schmalseite eines Ackers angrenzende Nachbarsacker‘ und wohl auch ‚Pflugwendestelle‘ vorliegen. (2) In Verbindung mit Tierbezeichnungen im BT wie Esel-, Gans-, Gaul, Hase- handelt sich es sich hingegen um FormN nach der Grundstücksform.
Wäljeskopf (Wèlljeskobb)
Der Begriff Wäljes ist (mir) noch unbekannt.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Zu althochdeutsch. kopf ‚Becher, Hinterkopf‘, mittelhochdeutsch. kopf st. M. ‚Becher, Hirnschale, Haupt‘, wohl einer Entlehnung aus lat. cûpa, cuppa ‚Becher‘. Daneben steht der Diminutiv Köpfchen. (1) In den Flurnamen kann die Bedeutung ‚kleine Erderhöhung, rundlicher Hügel, Bergkuppe‘, aber auch ‚äußerstes Ende‘ und in diesem Sinne ‚der an der Schmalseite eines Ackers angrenzende Nachbarsacker‘ und wohl auch ‚Pflugwendestelle‘ vorliegen. (2) In Verbindung mit Tierbezeichnungen im BT wie Esel-, Gans-, Gaul, Hase- handelt sich es sich hingegen um FormN nach der Grundstücksform.
Im Teich [eam dech]
Deutet auf Teiche hin. Tatsächlich sind in der Flur auch heute noch Fischteiche vorhanden die von dem aus der Bornwiese kommenden Bach gespeist werden.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Zu althochdeutsch. tîh ‚Deich, Damm‘, mittelhochdeutsch. tîch st. M. ‚Deich, Damm; Teich, Fischteich‘, seit dem 13. Jahrhundert auch bezeugt als Bezeichnung für kleine Trockentäler ohne Wasserlauf. Nhd. Deich ist im Grunde nur die ursprüngliche niederdt. Entsprechung von nhd. Teich, doch haben die Wörter unterschiedliche Bedeutungen angenommen. In Mittelhessen gilt Deich gleichermaßen für die Bedeutungen ‚Flussdamm, Bodenmulde‘ und ‚Teich, Weiher‘.
Tränksee [eam trenksie] (Drenksii)
Heute ist hier kein See mehr. Die Wiese/Weide ist jedoch heute noch so nass, dass an manchen Stellen keine Mahd erfolgen kann. Es ist davon auszugehen, dass in den leichten Mulden früher die Tiere getränkt werden (trinken) konnten.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Tränke: Teils zu ahd. trenka, mhd. trenke st. F. ‚Tränke‘, teils zu ahd. mhd. trenken sw.V. ‚zu trinken geben, tränken‘. Die Simplizia des Typs Bei der Tränk gehören zum Substantiv, den Komposita wie Tränksee, Tränkwiese liegt häufiger das Verb zu Grunde. Die Belege beziehen sich auf öffentliche Brunnen und seichte Stellen in Wasserläufen, an denen das Vieh getränkt wurde. Tränkgasse heißt ein Weg dorthin.
Totenweg [duure wääg]
Auf dem Totenweg mussten die Einwohner Wermertshausen von ca. 1577 bis 1772 ihre Toten auf den Friedhof nach Winnen bringen.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Tot: Die meisten Namen gehören zu althochdeutsch mittelhochdeutsch. tôt ‚gestorben‘. Sie verweisen auf Flurstücke an Friedhöfen, auf Wege, auf denen Tote zum Begräbnis getragen wurden usw. Mitunter erinnern sie an ein bestimmtes Ereignis, etwa die Entdeckung eines Toten (Toter Mann, Totmal). Totenhof ist ‚Friedhof, Begräbnisplatz‘. Der Name fand nur Anwendung, wenn der Friedhof nicht bei der Kirche lag (sonst Kirchhof, s.d.). Der Ausdruck ist erst nördlich von Gießen üblich. Manchmal meint tot aber auch nur ‚unergiebig, unfruchtbar‘ in Bezug auf Landstücke oder Gewässer. – In Einzelfällen kann auch der PN Dodo, Toto (s. Todenhausen) zu Grunde liegen
Aus der Monatsserie aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Gemeinde Ebsdorfergrund: Wermertshausen, das seit seiner frühesten Erwähnung bis in das 16. Jahrhundert kirchlich zu Ebsdorf gehörte, wurde 1577 in das lutherische Kirchspiel Winnen eingepfarrt. Dies bedeutete für die Wermertshäuser, dass sie nunmehr ihre Gottesdienste, Taufen und Trauungen in der Winnener Kirche hatten. Sogar die Toten mussten nach Winnen gebracht werden. Noch im Lager- und Steuerbuch von 1749 heißt es: “Keine Kirche ist allhier. Die Gemeinde ist angehalten, nach Winnen zu gehen, welches 1 ¼ Stunde von hier gelegen ist, auch ihre Todten dahin zu begraben….”. Erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts (1755) besitzt Wermertshausen ein Gotteshaus, ein schlichtes Fachwerkkirchlein mit einem kleinen Turm in der Mitte des Dorfes. Seit dieser Zeit hielt der Winner Pfarrer alle 14 Tage hier Gottesdienst. Ebenso fanden nun Taufen und Trauungen statt. Dagegen mussten die Kinder weiterhin zum Konfirmationsunterricht nach Winnen kommen. Mit dem Konfirmationsgottesdienst kam seit alters her die Zusammengehörigkeit des ganzen Kirchspiels zum Ausdruck. Noch im Jahr 1772 wurden die Verstorbenen von Wermertshausen auf dem jetzt noch vorhandenen Totenweg nach Winnen gebracht und dort beerdigt. Von diesem Jahr an jedoch durften die Wermertshäuser ihre Toten auf dem eigenen Gottesacker am Rande des Oberdorfes bestatten. Allerdings mussten sie nun eigens den Pfarrer von Winnen abholen und wieder zurück bringen.
Am 31.12.2011 endete die Geschichte des Kirchspiels Wermertshausen-Winnen-Nordeck nach 435 Jahren.
Würgeling [off’m werjeling] (Wearjeleang)
Der Name bezeichnet lange quer laufende Flurstücke.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Würgeling: Der verhältnismäßig häufige Flurname lässt sich mit werch (s.d.) ‚quer‘ und /-ling/ als Abschwächung von -länge oder -land deuten, entsprechend Wegling (s.d.). Der Name bezeichnet dann lange quer laufende Flurstücke.
Wann (di Wann)
Der Flurname geht wohl auf die tatsächlich vorhandene Bodensenke zurück, welche an eine Wanne erinnert.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Wanne: Wohl nur zum Teil zu Wanne in der Bedeutung ‚Bodensenke‘. Bei althochdeutsch. wanna, wan ‚Getreideschwinge, Wurfschaufel‘, mhd. wanne sw. st. F. ‚Getreide-, Futterschwinge; Wasch-, Badewanne; langrundes Metallgefäß‘, frühnhd. wanne, für das zusätzlich noch die Bedeutung ‚Flächenmaß‘ bezeugt ist, handelt es sich um eine Entlehnung aus lat. vannus ‚Futterschwinge‘. Wegen der gleichen Form wurde die Bezeichnung auch auf Wasch- und Badegefäße übertragen. Diese Form war dann namengebend für entsprechende Bodensenken. Wand- und Wannen-Namen sind aber nicht immer zu trennen. Einige Belege sind vielleicht als um das Präfix gekürzte Formen von Gewann (s.d.) anzusehen.
Krebestrauch [eam kreawesstroach]
Dieser Flurname ist heutzutage ungebräuchlich und die Herkunft nach dem hessischen Flurnamenarchiv Gießen scheint hier unpassend. Am wahrscheinlichsten entstammt der Flurname aus dem Familiennamen „Krebe“, welche einst Eigentümer dieser Flur waren. Unter Einheimischen wird die Flur heute als „Schönwandts Kobb“ bezeichnet. Bei dem Familienamen Schönwandt handelt es sich u.a. um Nachfahren der Familie Krebe.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Strauch: Benennungsmotiv ist der Bewuchs mit Sträuchern, Gesträuch, mittelhochdeutsch. strûch st. M. ‚Strauch‘. Der Name bezieht sich oft auch auf Busch- oder Niederwald.
Krebe: Zu mhd. krebe sw. M. ‚Korb‘, eigentlich ‚geflochtener Korb‘. Kreben waren eingezäunte Weideplätze für Vieh, insbesondere für Schweine. Sie gehörten zum Sonderland der Gemarkung. – Die Belege sind allerdings von Gräben ‚Gräben‘ (s.d.), vielleicht auch von mhd. grêve, grêbe, der mitteldt. Form von mhd. grâve ‚königlicher Gerichtsvorsitzender, Graf‘, oft nicht klar zu trennen, besonders wenn sie als BT vorkommen.
Krebs: Teils zum Familienname Krebs, der im Raum auch historisch mehrfach bezeugt ist; teils aber zu ahd. krebaz, mhd. krebez, krebz st. sw. M. ‚Krebs‘. Bis zum Ausbruch der Krebspest in Europa im Jahr 1875 lebte der Fluss- oder Edelkrebs auch in den meisten hess. Gewässern und wurde massenhaft gefangen.
Lochstück [eam lochsteck] (Lochschdegg)
Es könnte sich bei der Bezeichnung um ein Stück Land mit Geländevertiefungen wie Mulden handeln. Bei der heutigen Betrachtung stechen allerdings keine Geländevertiefungen ins Auge. Lochstück könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass hier einmal ein lichter Wald (Loh) befand, was aufgrund der (heutigen) Waldesnähe auch nahe liegen würde.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Loch: Wohl meist zu althochdeutsch. loh, loch ‚Loch, Öffnung, Hähle‘, mittelhochdeutsch. loch st.N. ‚Gefängnis, Versteck, Höhle, Loch, Öffnung‘. In Flurnamen bezieht sich Loch auf alle Arten von Geländevertiefungen, von der sanften Mulde bis zum steilen Taleinschnitt. Vermengungen bestehen mit anderen Namen, vor allem mit Loh und Lache 2 (s.d.).
Stück: Im Flurnamen Stück, ahd. stuki, mhd. stücke, stück, stucke, stuck st. N. ‚Teil wovon, Stück‘ schwingt meist die allgemeine Bedeutung ‚Acker, Feld, Land, Gartenland‘ mit, wobei die Teilbezeichnung für das Ganze steht (‚ein schönes Stück‘). Im Unterschied zu Südhessen, wo zahlreiche Vermengungen mit Stock (s. d.) und Stecken (s. d.) die Identifizierung erschweren, sind die mittelhessischen Vorkommen eindeutig.
Loh: Meist entweder zu ahd. lôh ‚Hain‘, mhd. lôch, -hes st. M.N. ‚Gebüsch, Wald, Gehölz‘ oder zu ahd. mhd. lô st.N., frühnhd. loe ‚Gerberlohe, Eichenrinde‘ (bzw. auch mhd. lô st. M. ‚zur Lohegewinnung angelegtes Gehölz‘). Die Namen beziehen sich entweder allgemein auf lichten Wald, kleine Gehölze und Gebüsch (worauf im Untersuchungsgebiet häufig auch der Name Hain verweist (s.d.)), oder speziell auf junge Eichenbestände, die zur Gewinnung von Gerberlohe genutzt wurden. Eine genaue Trennung der beiden namengebenden Motive ist meist nicht möglich; relativ sicher auf Lohe ‚Gerberrinde‘ weisen vermutlich die Namen Lohwald, Lohmühle, Lohkaute (als Bezeichnungen für Orte, wo Gerberlohe gewonnen, gemahlen oder gelagert wurde). – Häufig sind Belege mit der mittelhessischen Hebung /o:/ > /u/, gelegentlich ist das Genus des Flurnamens fem.
Triebacker [off de triw äcker] (Driwwägger)
Da auch Wege oder angrenzte Flurstücke, auf denen die Tiere zu den Weideflächen getrieben wurden, namengebend sein konnten (siehe Ganskopf) kann davon ausgegangen werden, dass am Triebacker entlang die Tiere zur Weide getrieben wurden
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Acker: Zu althochdeutsch. ackar, mittelhochdeutsch. acker st. M. ‚Acker, Feld‘. In FlN ist Acker im Untersuchungsraum über zweitausendmal belegt. Die sehr allgemeine Bedeutung (‚bebautes Land‘) erklärt die weite Verbreitung und das überwiegende Vorkommen als GT von Namenkomposita. Bei diesen sind hinsichtlich des namengebenden Motivs verschiedene Typen zu unterscheiden: die Benennung erfolgte nach dem Namen, Amt oder rechtlichen Status des Grundbesitzers (z.B. Herrenacker), nach der Beschaffenheit und Nutzung des Bodens (z.B. Steinacker), nach der Größe und Form des Geländes (z.B. Langacker), nach der relativen Lage zu bestimmten topographischen Punkten (z.B. Mühlacker) usw. In den frühen Belegen ist die Grenze zwischen Appellativ und Name manchmal noch fließend. Selten taucht Acker als BT oder Simplex auf.
Trieb: Wie mittelhochdeutsch. trip st. M. und trift ‚das Treiben, Weide‘ eine Substantivbildung zu ahd. trîban, mhd. trîben st.V. ‚treiben‘. Wie in heute noch gebräuchlichem ‚Auftrieb‘, ‚Abtrieb‘ zunächst der Weg zur Viehweide, dann aber auch schon früh der Weideplatz selbst.
Lindwiese [ean de leandwesse] (Leandwesse)
Auf diesem Flurstück standen bei der Namensgebung wohl Lindenbäume. Auch heute gibt es hier noch Lindebäume.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Linde: Zu althochdeutsch. linta, mittelhochdeutsch. linde sw. st. F. ‚Linde‘ (Tilia ulmifolia). Die Namen beziehen sich auf einzelnstehende Linden im Dorf und in der Feldflur, bei denen oft seit alters Versammlungs- und Gerichtsstätten lagen, oder auf vorwiegend mit Linden bestandene Waldstücke. – Der Anfang 14. Jahrhunderts für Bettenhausen und Birklar belegte <lindenenberg> scheint im BT das Adj. mhd. lindîn ‚von der Linde, aus Lindenholz‘ zu enthalten.
Wiese: Zu ahd. wisa, mhd. wise sw. st. F. ‚Wiese‘. In Flurnamen zeigt sich die allgemeine Bedeutung ‚zu mähende (kultivierte) Grünfläche‘.
Kastacker (Kasdägger)
Dieser Flurname ist unklar.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Kast: Unklar. Zu Kasten (s.d.) oder Kies (s.d.) (mit Kürzung, Senkung /i/ > (e) > /a/ und unorganischem /t/?).
Acker: Zu ahd. ackar, mhd. acker st. M. ‚Acker, Feld‘. In FlN ist Acker im Untersuchungsraum über zweitausendmal belegt. Die sehr allgemeine Bedeutung (‚bebautes Land‘) erklärt die weite Verbreitung und das überwiegende Vorkommen als GT von Namenkomposita. Bei diesen sind hinsichtlich des namengebenden Motivs verschiedene Typen zu unterscheiden: die Benennung erfolgte nach dem Namen, Amt oder rechtlichen Status des Grundbesitzers (z.B. Herrenacker), nach der Beschaffenheit und Nutzung des Bodens (z.B. Steinacker), nach der Größe und Form des Geländes (z.B. Langacker), nach der relativen Lage zu bestimmten topographischen Punkten (z.B. Mühlacker) usw. In den frühen Belegen ist die Grenze zwischen Appellativ und Name manchmal noch fließend. Selten taucht Acker als BT oder Simplex auf.
Weitershäuser und Mirtchesacker [off de merchäcker]
Der/die Flurname(n) gehen auf Familiennamen zurück, die wohl einst Eigentümer dieser Flächen waren.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Weitershausen: Die Belege in Langd und Rodheim a.d.H. beziehen sich auf die Wüstung Weitershausen, nordwestlich von Rodheim; zum Personennamen Wîtheri. Der Flurname in Nordeck geht hingegen auf den in Mittelhessen verbreiteten und hier historisch belegten Familienname Weitershaus zurück.
Auf’m trockenen See (off eam troggene Sii)
Beim Ursprung des Flurnamens sind zwei Ansätze denkbar: Hier könnte sich einst ein See befunden haben, der im Laufe der Zeit trockengefallen also verschwunden ist. Wasser zur Bildung eines Sees ist durch den naheliegenden Graben, der aus dem Elmensee stammt, vorhanden. Wahrscheinlicher ist aber, dass hier in niederschlagsstarken Jahreszeiten zur Bildung eines Sees kam, der dann bei Trockenheit wieder verschwand.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Trocken: Zu ahd. trucchen, mhd. trucken, trocken Adj. ‚trocken‘ als Bezeichnung für trockenes, unfruchtbares Gelände.
See: Zu ahd. se(o), mhd. sê st. M. ‚See‘. Bezeichnet See, wie im allgemeinen Sprachgebrauch, stehendes Gewässer, so haftet der Name heute häufig an flachen Flächen oder leichten Mulden, die in ihrer heutigen landwirtschaftlichen Nutzung kaum noch erkennen lassen, dass hier früher Wasser war. Auch wegen der sachlichen Nähe kommt es bei den Namen mit Diminutiv leicht zu Vermischungen mit Sechen (s.d.) (Garbenteich).
Elmensee [eam elmesie] (Elmesii)
Der Elmensee wurde in den 1960/70er angelegt. Wie der Flurname ist also vor Kurzem entstanden. Wie der Name zustande kam ist (mir) unbekannt.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Elme: Die historischen Belege stellen den Namen zu Elbe (s.d.); die Deutung ist damit auch hier unklar.
See: Zu ahd. se(o), mhd. sê st. M. ‚See‘. Bezeichnet See, wie im allgemeinen Sprachgebrauch, stehendes Gewässer, so haftet der Name heute häufig an flachen Flächen oder leichten Mulden, die in ihrer heutigen landwirtschaftlichen Nutzung kaum noch erkennen lassen, dass hier früher Wasser war. Auch wegen der sachlichen Nähe kommt es bei den Namen mit Diminutiv leicht zu Vermischungen mit Sechen (s.d.) (Garbenteich).
Wolfstrauch [eann de wolfstroich] (Wolfschdräuch)
Auf dieser auch heute noch mit Hutungen, Hecken und kleinen Waldinseln bewachsenen Flur in der Nähe des Waldes, hielten sich dereinst (und vielleicht bald wieder?) wahrscheinlich gehäuft Wölfe auf.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Strauch: Benennungsmotiv ist der Bewuchs mit Sträuchern, Gesträuch, mhd. strûch st. M. ‚Strauch‘. Der Name bezieht sich oft auch auf Busch- oder Niederwald.
Wolf: Wohl größtenteils zu althochdeutsch. mittelhochdeutsch. wolf st. M. ‚Wolf‘. Die Namen erinnern an bezeugte oder vermutete Aufenthaltsorte der Tiere. Die große Bedeutung der Wölfe und das Ausmaß der oft eingebildeten Bedrohung für die Menschen spiegelt sich in der Häufigkeit der Namen, insbesondere in der Vielfalt der Kombinationstypen wider. So weisen etwa Wolfsgarten, -grube, -kaute oder -loch auf Fallen zum Fangen der Wölfe hin. Die Wolfsfurt ist der Name des alten Lahnübergangs am Hoppenstein im Zuge der karolingischen Weinstraße. Wo der Familienname Wolf vorliegt, kann formal nicht festgestellt werden. Er ist auch historisch im Raum bezeugt. – Die Bedeutung von Wolf(s)zug ist unklar (s. Zug).
Helgeborn (Hèlljebonn) (heute Londorf aber historisch auch in Nordeck belegt)
Möglich das die Flur dereinst in kirchlichem oder klösterlichem Besitz war. Heute befindet sich hier eine Wasserquelle der Gemeinde Rabenau, sodass auch heute noch ein Born, also ein Brunnen vorhanden ist.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Heilig: Zu althochdeutsch. heilag, hêlag, hêlig, heileg, mittelhochdeutsch. heilec, heilic ‚heilig, geweiht‘. Die Namen verweisen auf Flurstücke in kirchlichem oder klösterlichem Besitz und auf Orte, an denen ein Heiligenbild (Heiligenhaus, -stock) steht. Der Flurname Heiliges Kreuz kann sich sowohl auf Weg- und Feldkreuze als auch auf Besitztümer eines gleichnamigen Klosters oder Spitals beziehen, wie das für den Flurname Heiliger Geist gilt – Der Heilige Stein in Muschenheim benennt eine Dolmenanlage.
Born: Zu althochdeutsch. brunno, purnno, mittelhochdeutsch. burne, born sw. M. ‚Brunnen, Quelle‘. Namengebend sind natürlich fließende, nicht gegrabene Quellbrunnen, aus denen geschöpft werden konnte; auch kleine Quellbrunnen im Walde und Wiesenquellen. Born ist eine mitteldt./niederdt. Form und durch /r/-Metathese aus oberdt. Brunnen, ahd. brunno, ‚Brunnen‘ entstanden.
Auf der Hute [off de hou] (die Hòu)
Der Flurname ist auf einen Weideplatz zurückzuführen, auf dem das Vieh gehütet wurde. Auch heute noch weidet hier vermehrt Vieh, welches sich durch die durchfließende Umbach tränken kann, sodass kein Wasser zu den Tieren gebracht werden muss, was die Hute zu einem guten Weideplatz macht.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
Hute: Zu althochdeutsch. huota ‚Wache‘, mittelhochdeutsch. huote, huot st. F., frühnhd. hut ‚Schaden verhindernde Aufsicht und Vorsicht, Bewachung, Behütung, Schutz‘. In Flurnamen bezieht sich Hute in erster Linie auf Weideplätze, wo das Vieh gehütet wurde, aber auch auf das gehütete Vieh selbst.
Im Marchenrödchen [eam märjerädche] (Maieräädche)
Die Herkunft des Flurnamens ist nicht eindeutig festzulegen. Rödchen bezieht sich auf jeden Fall auf Rodung, sodass dieses Stück Land dereinst urbar gemacht wurde. Marchen könnte nach Prof. Dr. Hans Ramge entweder auf Stuten (weibliches Pferd) oder auf einen Familien- oder Vornamen zurückzuführen sein.
Hessisches Flurnamenarchiv Gießen / Prof. Dr. Hans Ramge:
March: Die Deutung des Namens der großen Grenzflur zwischen Beuern und Reiskirchen und des Namens in Nordeck ist schwierig. Die nahe liegende Anknüpfung an althochdeutsch. marah, mhd. marc st. N. ‚Streitross‘ mit der mittelhochdeutschen Nebenform march ist ausgeschlossen, weil dieses Wort stark flektiert (marchs-). Die Schwierigkeit entfällt, wenn man mittelhochdeutsch merhe ‚Stute, Mähre‘ zu Grunde legt, weil der Stammvokal durchweg als <a,o> überliefert ist. Sprachlich unproblematisch ist der Anschluss an mittelhochdeutschen morhe, morche, more sw. F. ‚Möhre, Morchel‘, falls das ein namengebendes Motiv darstellt. Schließlich ist der altdeutsche Personenname Marcho als Namengeber keinesfalls auszuschließen.
Rod: Zu ahd. rot, rod, mhd. riute st.N.F.‚Rodung, durch Rodung urbar gemachtes Stück Land‘. Die zahlreichen Belege weisen eine Fülle von sprachlichen Varianten auf. Neben den häufigen /ro:t, rot/-Formen sind es vor allem /rö:de/-Formen. Soweit sie als Sg. fem. identifizierbar sind, gehen sie auf eine Nebenform von mhd. riute zurück, in der der Stammvokal gekürzt uns zu /ö/ gesenkt ist, um dann durch die Dehnung in offener Silbe zu /rö:de/ zu werden. /rö:de/ kann aber auch Plural zu Rod sein und konkurrieiert dann mit der Pluralform auf /-er/: Röder, mundartlich oft zu /re:rer/ entrundet und weiter zu /ri:rer/ gehoben. Rod-Formen erscheinen häufiger mit Senkung zu /a/ (Rad). Bei mündlichen /u:/-Formen wurde in der Regel angenommen, dass sie zu rot gehören, womit Vermengung ohnehin leicht möglich ist. Für den /d/-Laut kommt neben regelmäßigem Rhotazismus zu /r/ gelegentlich Lamdbazismus zu /l/ vor (Röder Loch in Odenhausen (Rabenau)). – In diesem wie in einigen andern Fällen ist nicht auszuschließen, dass die Namen an Siedlungsname Rod erinnern, über die aber nichts weiter bekannt ist.
Quellen:
Mittelhessisches Flurnamenbuch (MHFB): https://www.online.uni-marburg.de/lagis/mhfb/id_o.php?table=belegort&lines=10&ex=xs&suchlemma=nordeck&lemma=Nordeck®_id=71&chapter=Flurnamen+A-E
Hessisches Flurnamen Archiv: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/forschung/sprache/flurnamen
Helma Arnold (1985): Bei iis deheem – Die nordecker Mundart. Eigenverlag